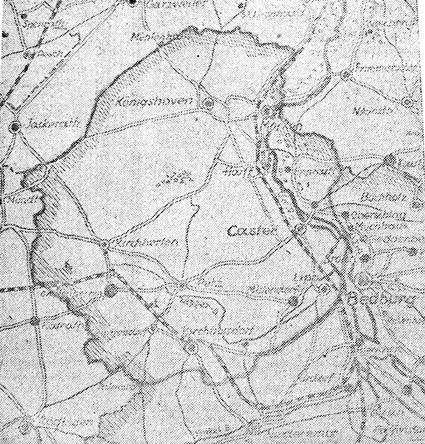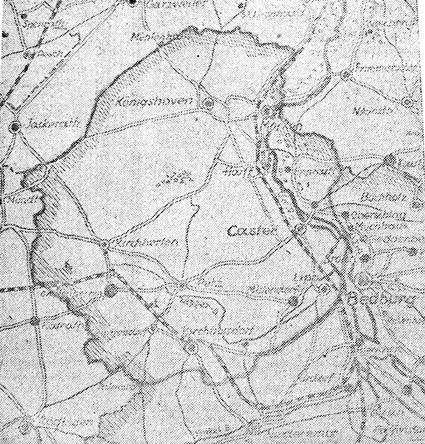Zeitungsartikel
Kölnische Rundschau vom 2. August 1949
Königshoven und seine Pfarrkirche
Das höchst gelegene Gotteshaus des Kreises
Das langhingestrecke Bauern- und Arbeiterdorf liegt in der
nördlichsten Ecke unseres Heimatkreises. Dem Wanderer, der zu Fuß oder mit der
Bahn durch das Erftland zieht, fällt sofort das hochgelegene Gotteshaus in die
Augen. Es ist eines der schönsten Kirchen in der weiter Runde. Sie ist der
Sammelpunkt in der Stille des Dorfes. Und nicht selten sind die Häuser, Höfe und
Hütten der Gemeinschaft alle wie Küchlein um die Henne dicht um das Gotteshaus
geschart. Ihre Väter haben sie nicht an die lärmende Straße gebaut. Noch heute
gehen Eisen- und Autobahn in weitem Bogen um das Dorf herum. Zu Füßen dieses
Heiligtums liegt der Friedhof ausgebreitet. Hier ruhen die Ahnen unter dem Rasen
zwischen den hohen Lebensbäumen, all die Tausende längst vergessener und
verschollener Menschen.
St. Peter ist eine alte Kirche. Sie wurde schon um das 14.
Jahrhundert genannt. Nach Vollendung eines zweischiffigen gotischen Baues im 15.
Jahrhundert, folgte 1676 die Errichtung einer Sakristei. Da die Kirche den
Ansprüchen der stetig wachsenden Gemeinde nicht mehr genügte, legte der damalige
Regierungsbaumeister Busch der bischöflichen Behörde neue Pläne vor. Daraufhin
wurde 1896 mit einem Erweiterungsbau begonnen. Man legte das Chor nieder und
ersetzte es durch einen Neubau. Königshoven besitzt die höchstgelegene Kirche
des Kreises. Es ist ein prächtiger Anblick, wenn man von hier oben in das weite
Erftland schaut, besonders jetzt zur Zeit der Ernte den Blick über das wogende,
fruchtbare Gefilde streifen läßt. Das Gotteshaus liegt auf einem hoch
aufgemauerten, nach Westen und Süden zu von Backsteinstreben gestützten Platz.
Sie ist mit dem Turm 28,30 Meter lang und 11,40 Meter breit. Der romanische
dreistöckige Turm stammt aus dem ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts und
besteht aus Tuff mit Eckquadern aus Trachyt. Er zeigt in jedem Stockwerk je zwei
große leicht zugespitzte Blenden, im letzten Geschoß einfache rundbogige Fenster
mit einem reichen Dachgesims unter der achtseitigen geschieferten Haube.
Das Langhaus besteht bis zum Kaffgesims aus wechselnden
Schichten von Tuff und Backstein, darüber vorwiegend aus Backstein. Das
Mittelschiff ist mit einfachem Satteldach eingedeckt, die vier Joche des
Seitenschiffes mit einzelnen abgewalmten Dächer. Im Innern werden die beiden
Schiffe durch drei achtseitige Pfeiler getrennt, die auf zweimal abgetreppten
reichprofilierten, 1,20 Meter hohen Sockeln stehen. Die Rippen, die ein scharfes
Schienenprofil zeigen, ruhen auf tief herabgezogenen Konsölchen.
Vielfach ist die Königshovener Kirche von Dieben
heimgesucht worden. Ende vorigen Jahrhunderts erbrachen Gottesschänder das
Tabernakel. Geweihte Hostien fand man am Tage nachher in der Klapperhöhle auf
Morken zu, wo heute ein Kreuz als Erinnerungsmal steht.
Auf Opfersinn und heiligem Heimatstolz haben die Bewohner
dieses Gotteshaus erstehen lassen. Groß, stark, kühn und feierlich beherrscht es
die unendliche Weiter der Landschaft. Und doch ist aller trutzige Machtwille
eingeschmolzen in den demütigen Dienst eines ewigen Willens! Die Kirche ist dem
Dorfe und seinen Bewohnern ans Herz gewachsen. Und ein wunderbarer Hauch berührt
einen jedesmal, wenn man nach längerer Trennung sich ganz still in dem
geheiligten Raum zur Andacht und Sammlung einfindet. Auch in Königshoven ist die
Kirche Seele und Mittelpunkt des Dorfes geblieben. In ihr hat die Kultur der
Gemeinde ihren Angelpunkt. Und Sonntags, wenn Pflug, Sense und Bergmannsarbeit
ruhen und feierliche Stille über dem Dorf liegt, dann ist es das Leben spendende
und Hoffnung verheißende Gotteshaus, welches das ganze Dorfvolk wie eine große
Familie vereint und sammelt.
Kirche im Dorf. - Heute richtet sich die Hoffnung des
christlichen Volkes neu und stark zu den mütterlichen Kräften der Erde, der
Scholle und des Dorfes hin, in dessen Mitte als ragendes Symbol sich St. Peter
zum Himmel erhebt.
####################################################################################
Dokumentation über Kriegsopfer
- Aus einem Zeitungsbericht 1988
Durch Feindeinwirkung gefallen
Reiner Görres legte Dokumentation über die 179 Königshovener Kriegsopfer vor
Königshoven. Rheinbraun-Pensionär Reiner Görres, den Bürgern im ort und in
der Umgebung als Hobbyfilme und Hobbyarchivar bekannt, hat jetzt nach
zweijähriger mühevoller Kleinarbeit eine Dokumentation über die 179 Kriegstoten
und Vermißten der alten Ortschaft Königshoven im Zweiten Weltkrieg
zusammengestellt.
Es ist eine für den Leser tiefergreifende Sammlung, die auch heute, 43 Jahre
nach Kriegsende, mit vielen Einzelschicksalen aufzeigt, welches Leid der Krieg
mit sich brachte und welche großen Opfer nahezu alle Familien der Ortschaft
Königshoven in den Kriegsjahren von 1939 bis 1945 bringen mußten.
Einen dicken Ringordner füllen die Klarsichthüllen mit den Fotos der Toten
und Vermißten, Bildern von Soldatengräbern, Todesanzeigen aus der Presse,
kirchlichen Totenzetteln, Mitteilungen von der Truppe, von Behörden,
Standesämtern sowie deutschen und ausländischen Suchdiensten für Vermißte.
Eine jede Klarsichthülle behandelt ein menschliches Schicksal: Männer, die
auf den Schlachtfeldern der Soldatentod starben oder als Vermißte gelten,
Jugendliche, die beim Schanzdienst in Linnich im Artilleriebeschuß umkamen und
Frauen und Männer, die bei den Kämpfen um die Ortschaft Königshoven im Februar
1945 zu Tode kamen.
„Die Dokumentation soll einmal als bleibende Erinnerung und Mahnung für alle
Zeiten in das Archiv der örtlichen, katholischen Kirchengemeinde St. Peter
übergehen“, erläuterte Hobbyarchivar Reiner Görres. Über die örtliche
Gedenktafel mit den Namen der Kriegstoten und Vermißten hinaus, die sich in der
Bürgerhalle befindet, wollte er auch die persönlichen Schicksale der 179
Kriegsopfer aufzeigen.
Behilflich waren bei der Zusammenstellung der Dokumentation, die einige
Hundert Hausbesuche und den Gang zu Standesämtern und Behörden erforderlich
machte, vor allem die Eltern, Geschwister und sonstigen Verwandten der
Betroffenen. Sie stellten bereitwillig das erforderliche Material zur Verfügung.
Die Einzelfotos zeigen Soldaten aller Waffengattungen, andere Fotos zeigen
das letzte Ruhegrab in fremder Erde. Zu lesen sind auch die schriftlichen
Bescheide der Kompanie- und Batteriechefs von der Front mit Gefallenen- oder
Vermißtenmeldungen, ferner Benachrichtigungs- und Beileidsschreiben der
zuständigen Behörden.
Einige Vermißtenschicksale wurden vom DRK - Suchdienst geklärt, andere in
Verbindung mit dem Exekutivkomitees der Allianz der Gesellschaften vom Roten
Kreuz und Roten Halbmond der UDSSR in Moskau. Die Bescheide geben Nachricht vom
Tod der Vermißten in russischer Gefangenschaft.
Als vermißt galt auch der Soldat Victor Josef Godesar, der an der Ostfront
eingesetzt war. Reiner Görres entdeckte kürzlich in einer
Wochenschau-Aufzeichnung aus dem Kriegsjahr 1944 auf einem Bildstreifen den
Soldaten Godesar. Zusammen mit drei anderen Soldaten überquerte er in einem Floß
einen Fluß. Görres fertigte einen Bildauszug und überbrachte das Foto den
Familienangehörigen von Victor Josef Godesar, der am 15. Dezember 1945 in
russischer Gefangenschaft in Atbassa in Sibirien verstorben ist.
Der erste Kriegstote der Ortschaft Königshoven war der Soldat Matthias Baum,
geboren 1915 in Königshoven. Sein Grab befindet sich auf dem örtlichen Friedhof.
Ein Teil der Dokumentation ist dem unfreiwilligen Opfergang von acht Jungen
im Alter von 14 bis 17 Jahren gewidmet. Mit vielen Jugendlichen aus dem Ort und
dem benachbarten Morken-Harff waren sie zum Schanzdienst hinter der Front bei
Linnich dienstverpflichtet worden.
Am 27. September 1944 wurden neun der Jungen um 20.15 Uhr durch einen
Artillerievolltreffer getötet, darunter waren sieben aus Königshoven. Ein achter
aus dem Ort, der schwerverletzt worden war, verstarb später.
Im Sterberegister des Standesamts Linnich sind sie gesammelt aufgeführt mit
dem Hinweis: „Durch Feindeinwirkung gefallen“. Görres, der selbst beim
Schanzdienst verpflichtet war, erlebte am Ort das unvergeßliche schreckliche
Ereignis.
Einbezogen in die Dokumentation wurden natürlich auch die acht Frauen und
Männer, die durch den Artilleriebeschuß beim Einmarsch der Amerikaner in den
Februartagen 1944 im Ort zu Tode kamen.
#################################################################################
Kölnische Rundschau vom 21. Januar 1950
Zerstückelung des Amtes
Königshoven
Königshoven. Nach dem ersten Weltkriege, als die Verwaltungskosten
die Steuerkraft und die Leistungsfähigkeit der Bürger erheblich überstieg, wurde
bei den maßgeblichen Gemeinde- und Amtsvertretungen in den Bürgermeistereien
Königshoven, Kaster und Pütz erwogen, diese Lasten durch eine Senkung der
Personalkosten zu vermindern. Damals zogen sich die Verhandlungen lange hin. Die
Vertreter, die an den Verhandlungen beteiligt waren, kamen zu der Entscheidung,
daß nur durch eine Zusammenlegung der Verwaltungen der drei Bürgermeistereien
eine erhebliche Einsparung möglich sei. Es war aber schwer, zu einer Einigung zu
kommen, weil man sich nicht darüber entscheiden konnte, ob eine einfache oder
eine größere Zusammenlegung zweckmäßig sei. Bei den Verhandlungen spielte die
Frage der Zusammenfassung von Bedburg, Kaster, Königshoven und Pütz oder die
Zusammenfassung Kaster-Königshoven-Pütz eine entscheidende Rolle. Ehe man sich
jedoch bei allen maßgeblichen Stellen und Instanzen auf eine bestimmt Linie
entschieden hatte, trat der Nationalsozialismus seine Herrschaft an und verfügte
kurzerhand die Zusammenfassung von Kaster, Königshoven und Pütz zu einer
einheitlichen Verwaltung. Wer mit den Verhältnissen vertraut ist, weiß, daß die
Ämterzusammenlegung gut gewählt war. Jedenfalls ist die Bevölkerung der drei
Ämter bis zum Jahre 1945 in finanzieller Hinsicht gut gefahren.
Als die Amerikaner 1945 den Kreis Bergheim besetzten, wurde Lipp von Bedburg
aus verwaltet. Von Kirchherten aus begann gegen die gemeinsame Amtsverwaltung
ein Kampf, der zuerst mit der Einrichtung einer einfachen und dann einer
erweiterten und demnächst einer vollständig eigenen Verwaltung enden soll. Diese
Bestrebungen zur Zerstückelung des Amtes Königshoven finden bei einigen Stellen
vollste Unterstützung.
Vor etwa 150 Jahren hat man Gemeinden und Bürgermeistereien eingerichtet und
Verwaltungen geschaffen. Zweifellos waren für die Abgrenzungen die damaligen
Verkehrsverhältnisse maßgebend. Inzwischen ist man vom schwerfälligen Fahrzeug
zum Fahrrad, zum Motorrad und zum leichten Wagen gekommen. Jedenfalls sollte man
heute nicht dazu übergehen, zu Lasten des armen Steuerzahlers große
Ortsverwaltungen aufzubauen, sondern man soll den Entwicklungen der Zeit
Rechnung tragen. In einem Artikel in der Kölnischen Rundschau vom 14. Januar
werden die Verhältnisse in Bezug auf die Entscheidung, die Lipp jetzt wegen
seiner Rückkehr zum Amte Königshoven treffen muß, vom Bedburger Standpunkt aus
betrachtet. Die Entfernungen von Bedburg bis Garsdorf bzw. Auenheim sind genau
soweit bzw noch weiter, als der Weg von Lipp bis Harff. Um der Bevölkerung von
Lipp den Weg nach Harff zu erleichtern, ließen sich dort auch Sprechstunden
einrichten. Bei den Entscheidungen, die von Lipp und von der Gemeinde Pütz zu
treffen sind, sollte man weniger auf rein örtliche Verhältnisse sehen, die sich
im Laufe der Zeit ändern werden; sondern es ist das große Ganze zu
berücksichtigen. Die nebenstehende Zeichnung beweist, daß das Amt Königshoven
einen schön abgerundeten Verwaltungsbezirk darstellt. Die Braunkohlenindustrie
ist dabei, in diesen Bereich vorzustoßen. Im Laufe der nächsten 50 Jahre wird
das ganze Gebiet des Amtes Königshoven umgestaltet werden.
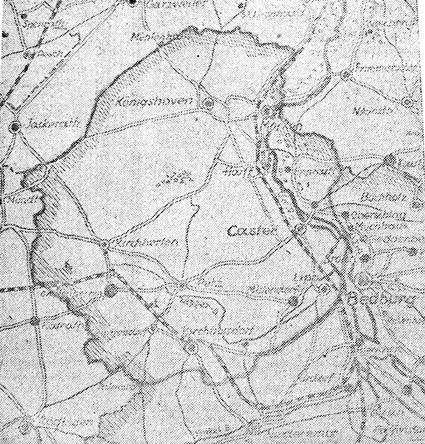
Es werden dort große Braunkohlengruben entstehen, deren Ausdehnung mit den
bisherigen großen Gruben kaum zu vergleichen sind. Ganze Orte werden durch diese
Auskohlung verschwinden. Bevor ein Stück des Amtes Königshoven (z.B. Lipp)
weggenommen, oder das Amt überhaupt zerstückelt wird, sollte die zukünftige
andere Gestaltung durch die Braunkohle abgewartet werden. Für die Umsiedlung von
Königshoven ist schon jetzt das Gebiet zwischen Kaster und Bedburg, also die
Gemarkung Kaster und Lipp, vorgesehen. Es wäre also falsch, Lipp aus dem Gebiet
des Amtes Königshoven herauszunehmen.
Wenn schon im Hinblick auf Lipp und im Hinblick auf die großen Planungen im
Amte Königshoven eine Zerstückelung und Zerschlagung von jedem vernünftig
denkenden Bürger, vor allem von jedem Verwaltungsbeamten abgelehnt werden muß,
möge man über diese Dinge nicht leichtfertig verhandeln und entscheiden. Das Amt
Königshoven bzw. die Bevölkerung, insbesondere die Vertreter derselben, werden
bei allseits gutem Willen sich mit den Vertretern der Stadt Bedburg über ein
Schema einigen, das allen Beteiligten gerecht wird.
Unsere Meinung:
Allgemeine öffentliche Abstimmung
Die Gemeinde Lipp ist leider zum Zankapfel zwischen dem Amt Harff und der
Gemeinde Bedburg geworden. Jedes Amt möchte natürlich durch die Mitverwaltung
der Gemeinde Lipp sein Gebiet vergrößern und seine Verwaltung stärken. Oder
liegt ausschließlich das Wohl der Bürger der Gemeinde Lipp beiden Ämtern so sehr
am Herzen? Jede Verwaltung führt bei der Diskussion der Frage der Umgemeindung
ihre eigenen Vorteile ins Feld. Es dürfte aber nicht Sache der beiden Ämter
sein, über diese wichtige Angelegenheit zu entscheiden, vielmehr müßte die
gesamte Wohnbevölkerung von Lipp hier gehört werden. Dies könnte in einer
allgemeinen Abstimmung geschehen, die von der Gemeindevertretung anzuordnen ist.
Natürlich wäre Sorge zu tragen, daß die Bevölkerung über das Für und Wider vor
der Abstimmung genügend aufgeklärt wird. Die Bevölkerung könnte dann auch nicht
den Behörden und der Vertretungskörperschaft über etwaige Nachteile, die sich
vielleicht aus der einen oder anderen Lösung ergeben, irgendwelche Vorwürfe
machen. Wenig zweckmäßig erscheint es auch, die Entscheidung über diese wichtige
Frage der Gemeindevertretung, die nur aus vier Mitgliedern besteht, zu
überlassen. Bei dem Vorschlag einer Abstimmung wollen wir ganz außer Betracht
lassen, daß der Wille von einzelnen Personen, die in dieser Angelegenheit etwa
ihre eigenen persönlichen Interessen verfechten möchten, sich ausschlaggebend
auf die Entscheidung auswirken könnte.
Mit Rücksicht darauf, daß die Landesregierung die endgültige Entscheidung
über die Umgemeindung bis Ende dieses Monats befristet hat, müßte die Abstimmung
allerdings recht bald erfolgen.
D.Red.
############################################################################
Kölnische Rundschau vom 22. April 1950
Frimmersdorf erschließt das Westfeld
Neuer Tagebau in der Königshovener Ackerzone unter neuem Gesetz
Königshoven. Es mögen rund fünfhundert Menschen - darunter nur zum
geringeren Teile Grubenfachleute und Techniker - zugegen gewesen sein, als in
der Nacht zum 2. April zwischen Morken und Gindorf der neue 1000-Tonnen-Bagger
der Grube Frimmersdorf im Lichte der Scheinwerfer in richtung Reisdorf in das
„Westfeld“ vorrollte. Diese Hundertschaften waren damit ebenso Zeugen des
entscheidenden Ansatzes eines neuen Entwicklungsabschnittes des Frimmersdorfer
Tagebaubetriebes wie der dadurch bedingten zukünftigen Umgestaltung der
Landschaft und Wirtschaft im Gebiete von Königshoven.
Mit dieser unmittelbar vor Morken eingeleiteten Westschwenkung greift die
Grube Frimmersdorf erstmalig aus ihrem ursprünglichen Erfttalstandort den
insgesamt rund 50 Meter hohen Sprungrand der westlich angrenzenden Bördeterasse
an. Das bedeutet gleichzeitig ihren Vormarsch aus dem ihr bisher eigentümlichen
Busch- und Bruchgebiet der Erftniederung in die Region der ungleich wertvolleren
Ackerböden der Lößzone.
Mit 21.000 cbm täglicher Leistung soll dabei der neu eingesetzte Riesenbagger
die gegenüber der Erftsohle mächtigere Deckschicht abräumen und die unter dieser
verborgene Braunkohle zur Auskohlung freilegen. Diese Deckschicht bildet
oberflächlich zunächst einmal wertvoller ackerbarer Boden - seit je Nährer
derer, die ihn bestellten; noch trägt er Weizen und Zuckerrüben. Darunter eichen
unfruchtbare Sande und Kiese bis hinab zu der zerfurchten Oberfläche des Flözes
...
Die hier anstehende Braunkohle wird ebenso wie die des bisherigen
Tagebaubetriebes ausschließlich als Kesselkohle für das Kraftwerk Frimmersdorf
Verwendung finden. Brikettierung gibt es in Frimmersdorf nicht, und statt
transportteurer Braunkohle liefert Frimmersdorf Braunkohlenenergie. Die an der
Nordgrenze des Villeflözes gelegene Grube Frimmersdorf ist nämlich die
Rohstoffbasis für das gleichnamige Kraftwerk, das bei vollem Ausbau der jetzigen
Anlage 90.000 Kilowatt leistet und damit einen beachtlichen Beitrag in der
westdeutschen Stromwirtschaft darstellt. Das am Nordrande der Grubenanlage
errichtete Kraftwerk ist daher auch der unverrückbare Festpunkt für das
Schwenksystem des gesamten Abbaubetriebes.
Vor genau 25 Jahren - im Mai 1925 - wurde mit dem Bau des Großkraftwerkes
Frimmersdorf begonnen und seit dem Jahre 1927 wird dieses mit Frimmersdorfer
Kohle versorgt. Zwar hatten „Dessauer Gas“ und Stadt Rheydt bereits während des
ersten Weltkrieges dort Bergwerkseigentum mit einem abbauwürdigen Vorkommen von
rund 240 Millionen Tonnen erworben. Aber die Ausbeutung dieser reichen Vorkommen
inmitten der Erftniederung hatte in den ersten Jahren mit erheblichen
Schwierigkeiten, nicht zuletzt infolge der Wasserverhältnisse, zu kämpfen. Die
dem Talgefälle der Erft folgenden mächtigen Grundwassermengen stellten die auf
diesem natürlichen Wasserspeicher errichteten Grubenanlagen vor gänzlich
neuartige und stetig wachsende Aufgaben.
Es ging hier um nicht weniger als eine gesamte Neuregulierung des
Wasserhaushaltes, und wenn es dabei gelang, schließlich jeglichen Einfluß des
Grundwassers im Grubenbetrieb auszuschalten, so nur dadurch, daß die Grube heute
jährlich 15 Millionen cbm Wasser aus ihrem Tagebau der Erft zuleitet.
Nicht minder schwierig und umfangreich war die Sicherung der oberirdischen
Wasserverhältnisse. Schon in der Frühzeit der Grube - im Mai 1926 - brachte eine
Wasserkatastrophe die mittlerweile gegründeten „Niederrheinischen
Braunkohlenwerke“ in arge Bedrängnis. Die Hochwasserfluten der Erft hatten
damals die Böschung durchbrochen, so daß die Grube für Monate zum Erliegen kam.
Mit den wachsenden Betriebsanforderungen war es unerläßlich, diese Gefahr ein
für allemal auszuschließen. Diese Sicherung wurde dadurch erreicht, daß die Erft
selber aus dem Bereich der Grube auf die äußerste Ostseite des Tales verlegt und
schließlich auch dem Königshovener Bach ein neuer Lauf gewiesen wurde. Das jetzt
in Angriff genommene
„Westfeld“ kennt solche Wassergefahren nicht.
Damit dürften hier die Betriebsverhältnisse weit günstiger liegen, zumal auch
eine gleichmäßigere Lagerung des Flözes zu erwarten ist. Das allerdings
mächtiger werdende Deckgebirge - in der Erftniederung beträgt die Decke im
Mittel nur 21 Meter und die Flözmächtigkeit durchschnittlich 26 Meter - fällt
angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten nur wenig ins Gewicht. Der
bereits vor dem Kriege gefaßte und jetzt im Einsatz des Großbaggers
verwirklichte Plan, den Tagebau in Zukunft nicht mehr wie bisher erftabwärts zu
treiben, sondern vor Morken aus der ursprünglichen Südrichtung nach Westen
einzuschwenken, hat damit sehr reale Gründe.
 40 Elektromotoren ermöglichen ihm 21.000 cbm Tagesleistung
40 Elektromotoren ermöglichen ihm 21.000 cbm Tagesleistung
Foto: Jacobs
Was Grube und Großkraftwerk bisher für die Bevölkerung
der anliegenden Orte bedeuten, ergibt sich aus der Tatsache, daß Frimmersdorf
mit 17,8 % der Ortsbevölkerung heute die höchste Bergarbeiterdichte aller
Erftorte
aufweist. (In Quadrath-Ichendorf machen die Bergleute 14,5 $ der Ortsbevölkerung
aus.) Selbst Harff bringt es dank Frimmersdorf noch auf 6,8 und Epprath auf 5,6
% Bergarbeiten.
Aber zwischen Morken und Frimmersdorf klafft heute ein gewaltiger Trichter mit
etwa 2 km Durchmesser. In diesem Krater wurde die Erftlandschaft in nicht ganz
25 Jahren zu urweltlichen Formen verwandelt. Hier ist, wie gesagt, im
wesentlichen ein Teil einer anheimelnden Landschaft untergegangen. In dem jetzt
in Angriff genommenen Westfeld mit seinen Ackerfluren, die gleichzeitig die
Existenzgrundlage eines Teiles der Bevölkerung der betroffenen Orte darstellen,
geht es um andere Werte. Und hier wird es sich erweisen, ob es gelingen wird,
neben der notwendig gewordenen Nutzbarmachung des im Untergrunde schlummernden
Reichtums gleichzeitig auch den ewigen Segen der Erde zu erhalten. So ist gerade
das Beispiel Königshoven wie kaum ein anderes des Kreises dazu angetan, die neue
Entwicklung des Braunkohlentagebaus unter dem Einfluß des Braunkohlegesetzes zu
verfolgen.
HOME